
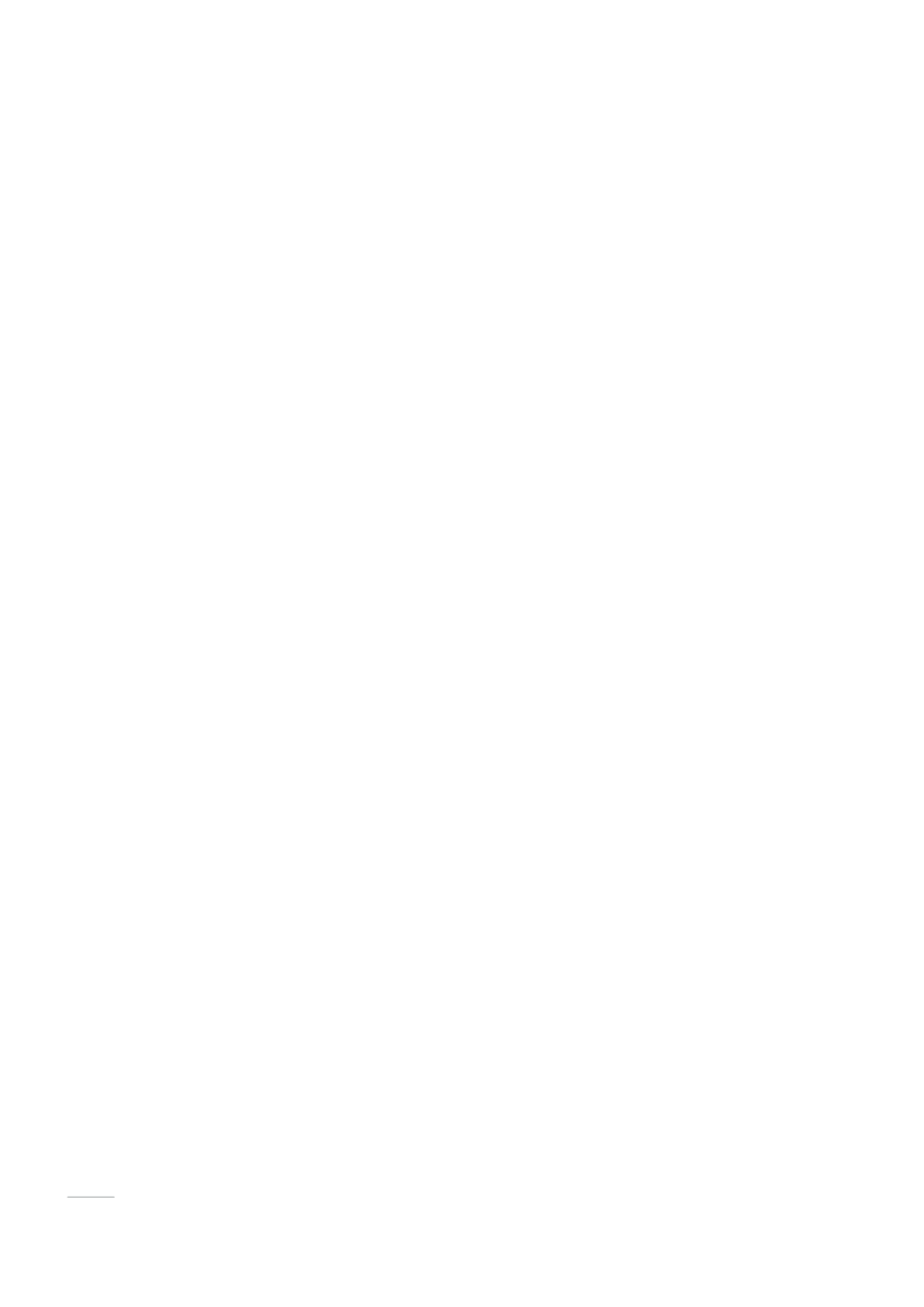
34
marktet. Aus diesem Geben und Nehmen können wichtige
Synergieeffekte entstehen. So schreibe ich beispielsweise
seit der Saison 2012/13 für das Mitgliedermagazin des FCK
eine Serie von Artikeln über die ehemaligen jüdischen
Vereinsmitglieder und deren Schicksal im „Dritten Reich“.
Auch unsere Frauenfußballtagung 2011 setzte wichtige
Impulse. Meine Zeitzeugen-Gespräche mit „Roten Teufe-
linnen“ aus den Anfangsjahren hatten zur Folge, dass sich
viele Spielerinnen nach über vierzig Jahren zum ersten
Mal wiedersahen. Sie organisieren derzeit ein Treffen
auf dem Betzenberg. Ist es nicht großartig, wenn das ein
unbeabsichtigter Nebeneffekt der sporthistorischen For-
schung ist?!
Wer Fußball in einer traditionsreichen Akademie neben
Aristoteles, Wittgenstein und der Geschichte des Schel-
menromans unterbringt, muss schon echter Fan sein.
Wie muss man sich den „Fußballer“ Markwart Herzog
vorstellen? Als Spieler beim TV Irsee vielleicht?
Nein, gewiss nicht, dafür bin ich mit meinen 57 Jahren
schon zu alt. Mein Interesse gilt der Geschichte, nicht der
Praxis des Fußballsports. Und vielleicht muss ich Sie jetzt
enttäuschen: Es ist kein Fußballverein, sondern der Rin-
ger-Club TSV Westendorf in der Nähe von Irsee, dessen
Heimkämpfe in der 2. Bundesliga ich regelmäßig besu-
che. Die Ästhetik des Ringens fasziniert mich mindestens
ebenso wie die des Fußballspiels. Nach einem Ringkampf
ist meine Stimme jedenfalls stärker angegriffen als nach
einem Fußballspiel – was meine Frau mit sehr gemischten
Gefühlen sieht.
Wie sehen Sie ganz allgemein die Rolle von Fußball und
Geschichtswissenschaft in Deutschland?
Die Sportwissenschaft hat sich, abgesehen von Michael
Krüger von der Universität Münster, weitgehend von der
Sportgeschichte verabschiedet. Hier zählt, vereinfacht
gesagt, nur noch Trainings- und Ernährungswissenschaft.
Kein Wunder, dass die wichtigen Veröffentlichungen zur
Fußballgeschichte heute von Allgemeinhistorikern stam-
men, vor allem Wolfram Pyta und Nils Havemann von der
Universität Stuttgart. Warum? Weil sie es als einzige schaf-
fen, interessante Forschungsprojekte aufzulegen und auch
die nötigen Drittmittel einzuwerben.
Und die Rolle der Schwabenakademie?
Wir sind die einzige Institution in Deutschland, die regelmä-
ßig und mit hohem wissenschaftlichem Anspruch solche
Konferenzen über Fußballthemen anbietet. Natürlich kom-
pensieren wir damit einen universitären Mangel, haben aber
gleichzeitig auch geholfen, die Fußballgeschichte über ihr
Mauerblümchen-Dasein hinaus zu einem ernst zu nehmenden
Forschungsfeld zu entwickeln. Der Bonner Historiker Dittmar
Dahlmann schrieb vor einiger Zeit, dass wir ein „Pionier der
Verwissenschaftlichung“ der Fußballgeschichte seien.
Seit Jahren boomt der Markt mit populären Vereins-
und Spielermonografien. Ihre Meinung zu dieser Form
der „Fußballgeschichtsschreibung“?
Grundsätzlich sehe ich das positiv. Allerdings sträube ich
mich als Historiker dagegen, wenn Legenden und Mythen
gestrickt werden, wie zum Beispiel die, dass Schalke 04 bis
weit ins 20. Jahrhundert eine Arbeitermannschaft gewesen
sein soll. Christoph Biermann hat dazu das Stichwort von
der „Malocherlüge“ geprägt. Oder wenn ich lese, dass der
Nationalspieler und Arisierungsprofiteur Matthias Sindelar
aus Wien ein Mann des Widerstands gewesen sei. Da kann
man sich bei Georg Spitaler eines Besseren belehren lassen.
Wenn die von Ihnen angesprochene „populäre Fußballge-
schichtsschreibung“ die aktuelle Forschung rezipiert, sollte
sie vor solchen Mythen der Sportgeschichte geschützt sein.
Und wäre eine große Bereicherung der Publizistik.
Wer ist Ihr Publikum? Kommen auch „normale“ Fußball-
fans nach Irsee?
Ja, viele, darunter oft echte Fachleute, die selbst einen
Vortrag halten könnten: Führungskräfte von Fußballmu-
seen und -archiven, Studierende, die an Abschlussarbei-
ten sitzen, aber auch Journalisten aus Rundfunk, TV- und
Printmedien, die gleichsam Wissen tanken möchten.
Bei der Tagung über Frauenfußball waren zum Beispiel
auch aktive Spielerinnen da. Zur Tagung über die deutsch-
israelische Fußballfreundschaft kam eine 88-jährige Dame,
eine begeisterte FCK-Anhängerin, zusammen mit einer et-
was jüngeren Begleiterin, die für ein Flüchtlingsprojekt in
ihrem Heimatverein den Kontakt zum DFB suchte. Letztlich
ist es in Irsee ein bisschen wie im Stadion: eine bunte und
sehr heterogene Mischung von Menschen, die den Fußball
lieben. Und so soll es auch sein.
















